
Im drittenTeil der Coaching-Serie erklärt Psychologe und Managementexperte MICHAEL SCHMITZ wie Führungskräfte ihren Teams ERFOLGSERLEBNISSE VERSCHAFFEN und so mehr Leistung und ein besseres Arbeitsklima bewirken.
Teams, Abteilungen und Unternehmen können erfolgreicher sein, wenn sie sich mehr Erfolgserlebnisse gönnen. Gemeint ist: sie müssen Erfolge erleben, verstehen, was sie unter den gegebenen Umständen tatsächlich erreichen können, Resultate der eigenen Wirksamkeit zuschreiben und darauf stolz sein. Und vor allem kleine Erfolge mehr würdigen, als sie dies gemeinhin tun. Gerade die kleinen Erfolge werden oft vernachlässigt. Der Blick richtet sich auf das, was in weiter Ferne liegt und noch nicht erreicht wurde.
Ferne Ziele sind aber nur über kleine Erfolge zu erreichen. Sie geben Selbstbestätigung und treiben voran. Das gelingt umso besser, wenn Teams „Katalysatoren“ für Erfolg identifizieren, die zwischenmenschlichen Beziehungen „nähren“, Leistungshemmer aus dem Weg räumen und vermeiden, was die Stimmung runterzieht. Wie das funktioniert, erklären Harvard-Business-School-Professorin Teresa Amabile und Psychologe Steven Kramer, die ihren Ansatz als „Das Erfolgsprinzip“ beschreiben. Begründet auf einer großangelegten Studie identifizierten sie drei Faktoren, die in besonderer Weise gute Zusammenarbeit und Ergebnisse fördern, und zwei Faktoren, die sich entscheidend negativ bemerkbar machen.
Als positive Faktoren führen sie an:
- Fortschritte in der Bewältigung von Aufgaben in Form von sichtbaren, messbaren kleinen Erfolgen.
- Ereignisse und Maßnahmen, die das Vorankommen fördern – Zielsetzungen, Ressourcen, Budgets, Ideen, Handlungsfreiheit; praktische Unterstützung durch Kollegen und Vorgesetzte, um Aufgaben zu bewältigen; ein Arbeitsumfang, der in angemessener Zeit zu bewältigen ist.
- Ereignisse und Beziehungen zwischen Menschen, die gute Gefühle stärken wie Aufmerksamkeit, Respekt, Anerkennung, Wertschätzung – der Person, nicht nur der Mitarbeit, Ermunterung, Ermutigung, Vertrauen, Zugehörigkeit, Trost, Stolz.
Negativ wirken dagegen:
- Mangelnde Unterstützung, Abzug von Ressourcen, Budget-Cuts, Markteinbrüche
- Interaktionen oder Verhaltensweisen von Personen, die negative Gefühle hervorrufen und dadurch Aufmerksamkeit, Motivation und Leistungsfähigkeit schwächen (Konfrontationen, harsche Tonlagen, Vorwürfe, Mangel an Respekt, Kälte im Umgang, persönliche Abwertung). Sie wirken wie Gift.
Erfolgserlebnisse fördern
Für Teams, die ihren Erfolg optimieren wollen, kommt es darauf an, die positiven Faktoren gezielt zu fördern und die negativen möglichst auszuschalten. Diese Anforderung gehört zu den Managementaufgaben, die ein Coach bewusstmachen sollte. Das ist noch wichtiger, als sich mit den persönlichen Eigenheiten einzelner Teammitglieder zu beschäftigen.
Umfragen unter Managern zeigen, dass sie selbstverständlich Erfolg anstreben – aber wenig tun, um Erfolgserlebnisse zu fördern. Manager pflegen eher die Vorstellung, es reiche aus, Ziele zu setzen, Anreize zu bieten und Leistung zu belohnen. All das ist gut und richtig. Aber das Management von Erfolgen kommt dabei kurioserweise zu kurz.
Als Aufgaben für Führungskräfte wären zu formulieren:
Was können wir tagtäglich tun, um Erfolge erreichbar und erlebbar zu machen? Welche Orientierung müssen wir unseren Mitarbeitern dafür geben, welche Unterstützung zur Verfügung stellen? Welche Hindernisse müssen wir aus dem Weg räumen?
Welche zwischenmenschlichen Störungen haben wir zu beseitigen?
Mit Prozessvorgaben, Rollenverteilung, Strukturfestlegungen und ruhiger, routinierter Arbeit ist es nicht getan. Unter Managern ist nach wie vor die Haltung verbreitet: „Nicht kritisiert ist genug gelobt.“ Das jedoch ist eine kontraproduktive Verweigerung von Erfolgserlebnissen. Das ist Missmanagement.
Wie Erfolge zu managen sind
Erfolge zu managen bedeutet, Arbeitsabläufe, Aufgaben und Projekte in eine Vielzahl gut erreichbarer Teilziele herunterzubrechen, um so eine zügige Folge von „Teilsiegen“ aufstellen zu können. Das Anspruchsniveau ist dabei zu definieren. Es geht nicht um große Errungenschaften oder Durchbrüche. Wer stets nur das Fernziel vor Augen hat, beschert sich vornehmlich das Empfinden, weit davon entfernt zu sein. Das führt eher zu Frust, als dass es stimuliert.
Fortschritte müssen schnell machbar und sichtbar sein. Das zeigt sich meist in kleinen Ereignissen. Diese Ereignisse im Team bewusstzumachen, sie zu würdigen und innerlich festzuhalten, ist wichtig. Sie fördern das Bewusstsein, wirksam zu sein, durch eigene Fähigkeiten voranzukommen. Das wiederum fördert Selbstbewusstsein, Engagement, Energie, Ausdauer und Zufriedenheit – eine Zufriedenheit, die nicht abkippt in Selbstzufriedenheit, weil Erfolge verknüpft sind mit weiter gehenden und überschaubaren Zielen. So ist es möglich, Wünsche nach neuen Erfolgserlebnissen zu wecken und zu erfüllen.
Seelennahrung
Mitarbeiter – und das schließt Führungskräfte mit ein – müssen spüren, dass ihre Leistung von ihren Vorgesetzten und ihrem Unternehmen wahrgenommen und geschätzt wird. Das gelingt nicht mit der Überweisung ihres Gehaltes, sondern nur mit Zuwendung. Das ist Nahrung für die Seele. Werden Aufmerksamkeit, Anerkennung und Wertschätzung vorenthalten, untergräbt das Engagement und Leistungsbereitschaft.
Der Vorgesetzte macht’s
Wir bringen für unsere Arbeit viel Zeit auf – mehr als für alles andere. Daher sind die Erwartungen hoch, mit unserer Arbeit zufrieden zu sein. Umso gravierender, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt, sondern anhaltend enttäuscht werden. Meist hat das mit dem unmittelbaren Vorgesetzten zu tun, der wie kein anderer bestimmt, wie man miteinander umgeht und welches Klima herrscht.
Schlechte Stimmung entsteht, wenn Vorgesetzte
- sich immer wieder in die Arbeit ihrer Mitarbeiter einmischen mit Kontrollen, Kommentaren und Kritik;
- nur sagen, was ihnen nicht passt, was nicht reicht, was noch fehlt;
- kaum würdigen, was gut gelungen ist;
- den Druck, den sie von oben spüren, durch Zielvorgaben und Erwartungen direkt nach unten weitergeben.
Negative Erlebnisse bei der Arbeit wie Konflikte mit Vorgesetzten wirken sich unmittelbarer, heftiger und anhaltender auf die Stimmung aus als positive Erlebnisse. Studien legen nahe, dass negative Ereignisse etwa fünfmal stärker auf die Stimmung schlagen, als positive Erlebnisse die Stimmung verbessern. Mitarbeiter erinnern sich eher an negative Begegnungen mit ihren Vorgesetzten als an positive; sie tun dies viel detaillierter und mit größerer Intensität. Und das hemmt ihre Produktivität.
Vorgesetzte unterschätzen, wie schnell und anhaltend sie negative Wirkungen bei ihren Mitarbeitern auslösen können, wenn sie
- ihnen Fehler vorhalten, ohne zu berücksichtigen, unter welchen Umständen sie entstanden sind;
- nicht würdigen, welche Leistung sonst erbracht wird;
- den Mitarbeitern nicht ausreichend vermitteln, was sie tun sollen;
- Ideen und Vorschläge ignorieren oder abblocken, indem sie ihre eigene Meinung dagegensetzen, ohne auf Bemerkungen von Mitarbeitern einzugehen und darin das Produktive zu suchen;
- einzelne vor anderen infrage stellen, sodass diese sich vorgeführt fühlen;
- immer wieder Mikromanagment betreiben und so Mitarbeitern zu verstehen geben, dass sie ihnen nicht zutrauen, ihre Arbeit selbstständig zu erledigen;
- Mitarbeiter unter Druck setzen, indem sie ihnen zusätzliche Aufgaben zuteilen, ohne zu merken, dass schon mit den bisherigen Aufgaben die Belastungsgrenze erreicht ist.
Unzufriedenheit in der Arbeit okkupiert leicht Denken und Empfinden. Sie wird schnell zu einem beherrschenden Thema und bestimmt den Umgang mit anderen, nicht nur am Arbeitsplatz. Um das Erfolgsprinzip in Gang zu setzen, muss die eigene Arbeit als sinnvoll angesehen werden. Sie muss Bedeutung haben, darf nicht nur irgendein Job sein oder eine bloße Verpflichtung. Ob das der Fall ist, hängt davon ab, wie sehr die tatsächlichen Aufgaben zu den Fähigkeiten und Interessen des Einzelnen passen und wie sehr jeder erleben kann, dass die persönlichen Leistungen zum Gelingen größerer Aufgaben beitragen – dazu, dass Teamund Unternehmensziele erreicht werden. Für einzelne Mitarbeiter ist das oft nicht unmittelbar zu sehen. Das heißt: Es muss ihnen vermittelt werden, von den anderen im Team, vom direkten Vorgesetzten und übergeordneten Ebenen ihrer Organisation. Diese Aufgabe geht kaskadenartig von oben nach unten, über alle Ebenen hinweg.
Führungskräfte müssen Sinn erleben und Sinn stiften. Auch dazu sind sie als Coaches in besonderer Weise gefordert, auf allen Ebenen, auch gegenüber den ihnen jeweils unterstehenden Führungskräften. Leitende brauchen diese Vermittlung ebenso wie Nicht-Leitende. Damit ist die Gesamtverantwortung dafür ganz oben im Unternehmen angehängt. Die Vermittlung muss konkret, nachvollziehbar und glaubwürdig sein. Ein allgemeines Lob bringt nichts. Das klingt hohl und ist schnell verrauscht. Mit blumigen Erklärungen und Manager-Sprech ist es nicht getan. Das wird als fade Feiertagsrede oder Führungsphraseologie wahrgenommen.
In Teams muss es nicht immer fröhlich zugehen. Wenn es ein Problem zu lösen gilt, kann aus Anspannung auch Spannung entstehen. Schlechte Stimmung mag aufkommen. Problembewusstsein signalisiert, dass ein Problem gelöst werden muss und erhöht so die Fokussierung auf die Problemlösung. Menschen leisten anhaltend mehr, wenn sie in ihrem Beruf zufrieden sind, ihre Arbeit mögen, sich mit ihren Kollegen und Vorgesetzten wohlfühlen und ihr Unternehmen schätzen. Mitarbeiterzufriedenheit entsteht nicht nur aus der unmittelbaren Arbeit, sondern verlangt ganz wesentlich ein gutes persönliches Verhältnis zu den direkten Vorgesetzten, in weiterer Folge Zutrauen zur Führung insgesamt und ein gutes Ansehen des Unternehmens in der Öffentlichkeit.
Gute Stimmung fördert Engagement und Zusammenarbeit
Ein gutes Arbeitsklima fördert persönliches Engagement, Kooperation und Kreativität. Die Bereitschaft und die Fähigkeit, Probleme zu lösen, steigen. Bei schlechtem Arbeitsklima und mieser Stimmung kippen Leistungsbereitschaft, Zusammenarbeit, Kreativität, Engagement und Ergebnisse. Unzufriedenheit fokussiert die Aufmerksamkeit immer weiter auf alles, was unzufrieden macht. Dadurch verengt sich die Perspektive – die Übersicht und die Orientierung auf weitreichende Ziele gehen verloren.
Erfolgsparameter den Umständen anpassen
Die Stimmung und das Klima verschlechtern sich, wenn die Umstände sich so ändern, dass Erfolge schwieriger und in geringerem Maße zu erreichen sind. Zum Beispiel, wenn Ressourcen gekürzt, Budgets gekappt, Arbeitskräfte verschoben werden. In Zeiten der Umstrukturierung gilt es daher, Erfolg neu zu definieren, die Parameter anzupassen, klarzumachen, was unter veränderten Bedingungen erreicht und als Erfolg gewertet werden kann. Das ist vornehmlich die Aufgabe von Coaching, das führt. Wenn es etwa darum geht, bei einer angespannten Marktlage Kosten zu sparen, und frühere Umsätze nicht zu erzielen sind, können auch Umsatzeinbrüche, die ein bestimmtes Maß nicht überschreiten, ein Erfolg sein.
Ansteckende Gefühle
Gefühle sind ansteckend, die positiven wie die negativen. Wer Erfolge erlebt, strahlt Zufriedenheit aus. Die Welt wird anders erlebt. Zufriedene Menschen nehmen Teammitglieder und Vorgesetzte eher als förderlich und unterstützend wahr und gehen freundlicher auf sie zu. Freundlichkeit fördert Freundlichkeit.
Während Erfolgserlebnisse die Leistungsspirale nach oben treiben, führt das Empfinden von Verlusten und Niederlagen immer weiter nach unten. Motivation und Zuversicht lassen nach. Etwa wenn man merkt, dass Kollegen und Vorgesetzte sich mehr um sich selbst und ihr persönliches Fortkommen kümmern als um den Gesamterfolg und man daher nicht die Unterstützung von ihnen bekommt, die nötig wäre. Wird gemeckert und gemosert, hinter dem Rücken schlecht geredet, abgekanzelt oder gegrätscht, so nimmt der Stimmungsund Leistungsabschwung weiter Fahrt auf. Dann sind Coaches ganz besonders gefordert, dem Erfolgsprinzip wieder Geltung zu verschaffen.











 Michael Schmitz lernte als Journalist die Mächtigen der Welt kennen. Macht ist immer eine Kommunikationsleistung, sagt der Psychologe. Den goldenen Weg dahin müsse jeder selbst finden.
Michael Schmitz lernte als Journalist die Mächtigen der Welt kennen. Macht ist immer eine Kommunikationsleistung, sagt der Psychologe. Den goldenen Weg dahin müsse jeder selbst finden.
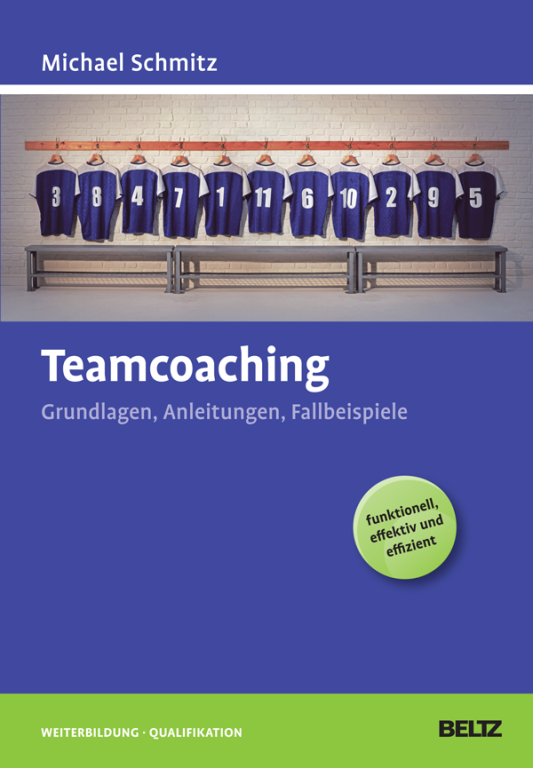 Ja, es gibt sie noch: Helden! Ein Blick in die Zeitun- gen genügt: “Thielemann erobert Salzburg”, “Van Persie erledigt Piräus im Alleingang”, “Marchionne haucht Chrysler neues Leben ein”, “Bezos lässt sei- ne Effizienzmaschine Amazon weiter auf Hochtouren laufen” oder “Reitzle hat den Konzern neu ausgerich- tet, ihn unabhängig und resistent gegen äußerliche Begehrlichkeiten gemacht und auf eine stabile, Wachstum versprechende Basis gestellt”.
Ja, es gibt sie noch: Helden! Ein Blick in die Zeitun- gen genügt: “Thielemann erobert Salzburg”, “Van Persie erledigt Piräus im Alleingang”, “Marchionne haucht Chrysler neues Leben ein”, “Bezos lässt sei- ne Effizienzmaschine Amazon weiter auf Hochtouren laufen” oder “Reitzle hat den Konzern neu ausgerich- tet, ihn unabhängig und resistent gegen äußerliche Begehrlichkeiten gemacht und auf eine stabile, Wachstum versprechende Basis gestellt”.
 „La Mannschaft“ – das Slogan und Programm. Für Frankreich. Für die EM. Ja, überhaupt. Es verkündet Selbstbewusstsein. Und Selbstverständnis. Der Begriff bringt ein Konzept auf den Punkt. Er transportiert die zentrale Idee in einem Wort: Große Erfolge sind nur durch beharrliche Teamarbeit möglich! Als Ergebnis von Zusammenarbeit und Zusammenhalt!
„La Mannschaft“ – das Slogan und Programm. Für Frankreich. Für die EM. Ja, überhaupt. Es verkündet Selbstbewusstsein. Und Selbstverständnis. Der Begriff bringt ein Konzept auf den Punkt. Er transportiert die zentrale Idee in einem Wort: Große Erfolge sind nur durch beharrliche Teamarbeit möglich! Als Ergebnis von Zusammenarbeit und Zusammenhalt!  Deutschland bringt Top-Spieler mit individueller Klasse hervor. Das Land verfügt aber nicht über Superstars wie Ronaldo, Messi oder Neymar. Solche Spieler, räumt Löw ein, fehlen den Deutschen. „Unsere Mannschaft ist eine Kombinatsmaschine“. Ihr fehlten die unberechenbaren Künstler am Ball, die Gegner immer wieder überraschen, im Spiel Mann-gegen-Mann, auf engstem Raum. Von solchen Talenten träumt jeder Trainer und jeder Fußballfan. Allerdings: Trainer (und Chefs in Betrieben) erliegen leicht der Verführung, sich an ihre Stars zu klammern das Spielkonzept zu sehr nach herausragenden Individualisten auszurichten – und so kollektive Möglichkeiten nicht optimal auszunutzen. Superstars sind oft auch Super-Egos. Sehen vornehmlich sich, betrachten andere als Zulieferer und lassen sie nicht richtig zum Zuge kommen. Und dann ist das Team nicht so gut wie es sein könnte – selbst ohne den großen Star.
Deutschland bringt Top-Spieler mit individueller Klasse hervor. Das Land verfügt aber nicht über Superstars wie Ronaldo, Messi oder Neymar. Solche Spieler, räumt Löw ein, fehlen den Deutschen. „Unsere Mannschaft ist eine Kombinatsmaschine“. Ihr fehlten die unberechenbaren Künstler am Ball, die Gegner immer wieder überraschen, im Spiel Mann-gegen-Mann, auf engstem Raum. Von solchen Talenten träumt jeder Trainer und jeder Fußballfan. Allerdings: Trainer (und Chefs in Betrieben) erliegen leicht der Verführung, sich an ihre Stars zu klammern das Spielkonzept zu sehr nach herausragenden Individualisten auszurichten – und so kollektive Möglichkeiten nicht optimal auszunutzen. Superstars sind oft auch Super-Egos. Sehen vornehmlich sich, betrachten andere als Zulieferer und lassen sie nicht richtig zum Zuge kommen. Und dann ist das Team nicht so gut wie es sein könnte – selbst ohne den großen Star.  Strategie besteht immer aus einem Set von Entscheidungen. Die einzelnen Maßnahmen müssen zusammenpassen. Sie sind nicht nur eine Addition einzelner Aktivitäten. Sie müssen aufeinander abgestimmt und konsistent sein, ineinandergreifen und sich gegenseitig verstärken. Harvard-Strategen nennen das „fit“. Ebenso wichtig, wie die Entscheidung, was zu tun ist, sind die Entscheidungen, was nicht zu tun ist. Das mag banal klingen. Tatsächlich werden solche Entscheidungen aber oft unterlassen. Sie verlangen immer „trade-offs“, bewusst in Kauf genommene Abstriche, wie Strategie-Guru Michael Porter argumentiert. – Unternehmen, die auf hohe Qualität setzen, können mit Produkten und Services nicht billig sein. Billige Ware liefert kein high-end. Wer im Fußball aggressives Pressing und schnelles Umschalten spielen lässt (wie Jürgen Klopp, früher mit Dortmund, heute mit Liverpool), nimmt filigranen Techniker viele Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten optimal zur Geltung zu bringen – mit rasanten Läufen und intelligenter Spielgestaltung. Anders ist der sogenannte „Ballbesitz“-Fußball, bei dem weniger gerannt, der Ball mehr kontrolliert, genauer gepasst und das Spiel überlegter aufgebaut und der Raum gezielter geöffnet wird. Diese Variante bevorzugen (jetzt in Dortmund) Thomas Tuchel, Jögi Löw oder Pep Guardiola.
Strategie besteht immer aus einem Set von Entscheidungen. Die einzelnen Maßnahmen müssen zusammenpassen. Sie sind nicht nur eine Addition einzelner Aktivitäten. Sie müssen aufeinander abgestimmt und konsistent sein, ineinandergreifen und sich gegenseitig verstärken. Harvard-Strategen nennen das „fit“. Ebenso wichtig, wie die Entscheidung, was zu tun ist, sind die Entscheidungen, was nicht zu tun ist. Das mag banal klingen. Tatsächlich werden solche Entscheidungen aber oft unterlassen. Sie verlangen immer „trade-offs“, bewusst in Kauf genommene Abstriche, wie Strategie-Guru Michael Porter argumentiert. – Unternehmen, die auf hohe Qualität setzen, können mit Produkten und Services nicht billig sein. Billige Ware liefert kein high-end. Wer im Fußball aggressives Pressing und schnelles Umschalten spielen lässt (wie Jürgen Klopp, früher mit Dortmund, heute mit Liverpool), nimmt filigranen Techniker viele Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten optimal zur Geltung zu bringen – mit rasanten Läufen und intelligenter Spielgestaltung. Anders ist der sogenannte „Ballbesitz“-Fußball, bei dem weniger gerannt, der Ball mehr kontrolliert, genauer gepasst und das Spiel überlegter aufgebaut und der Raum gezielter geöffnet wird. Diese Variante bevorzugen (jetzt in Dortmund) Thomas Tuchel, Jögi Löw oder Pep Guardiola. Aufgabe von Führung – von Team-Chefs in allen Bereichen und auf allen Ebenen – ist, die Strategie zu kommunizieren und die Bedingungen für funktionelle Kooperation und gutes Miteinander zu schaffen. Löw und Co. betonen immer wieder, wie wichtig soziale Kompetenzen und Kommunikation für „La Mannschaft“ sind. Kommunikation meint nicht, viel miteinander zu reden, sondern gut miteinander zu reden – so, dass Verständigung erzielt wird. Das gelingt nicht dadurch, dass einer lange Vorträge hält und Zuhörer stumm dasitzen. Es gelingt nur durch Einfachheit, Klarheit, Kürze, Prägnanz und durch ständige Rückversicherung, ob tatsächlich gehört wurde, was gesagt werden wollte. Ohne solche Feedback-Loops entsteht keine gemeinsame, koordinierte, zielgerichtete Aktion – es entsteht keine Mannschaft.
Aufgabe von Führung – von Team-Chefs in allen Bereichen und auf allen Ebenen – ist, die Strategie zu kommunizieren und die Bedingungen für funktionelle Kooperation und gutes Miteinander zu schaffen. Löw und Co. betonen immer wieder, wie wichtig soziale Kompetenzen und Kommunikation für „La Mannschaft“ sind. Kommunikation meint nicht, viel miteinander zu reden, sondern gut miteinander zu reden – so, dass Verständigung erzielt wird. Das gelingt nicht dadurch, dass einer lange Vorträge hält und Zuhörer stumm dasitzen. Es gelingt nur durch Einfachheit, Klarheit, Kürze, Prägnanz und durch ständige Rückversicherung, ob tatsächlich gehört wurde, was gesagt werden wollte. Ohne solche Feedback-Loops entsteht keine gemeinsame, koordinierte, zielgerichtete Aktion – es entsteht keine Mannschaft.

 Darwin. Na Klar. Weiß jeder Manager: In einer Welt, die sich ständig verändert, überlebt nur derjenige, der sich schnell genug anpasst. Doch immer wieder bleiben viele auf der Strecke. Es ist offensichtlich nicht einfach. Noch schwerer ist es, selbst Entwicklungen anzustoßen, mit denen die Regeln für den Überlebenskampf neu geschrieben werden – durch Unternehmen, die ganz neue Produkte und Dienstleistungen anbietet. Wie Amazon, Apple, Google, Tesla, Uber.
Darwin. Na Klar. Weiß jeder Manager: In einer Welt, die sich ständig verändert, überlebt nur derjenige, der sich schnell genug anpasst. Doch immer wieder bleiben viele auf der Strecke. Es ist offensichtlich nicht einfach. Noch schwerer ist es, selbst Entwicklungen anzustoßen, mit denen die Regeln für den Überlebenskampf neu geschrieben werden – durch Unternehmen, die ganz neue Produkte und Dienstleistungen anbietet. Wie Amazon, Apple, Google, Tesla, Uber.