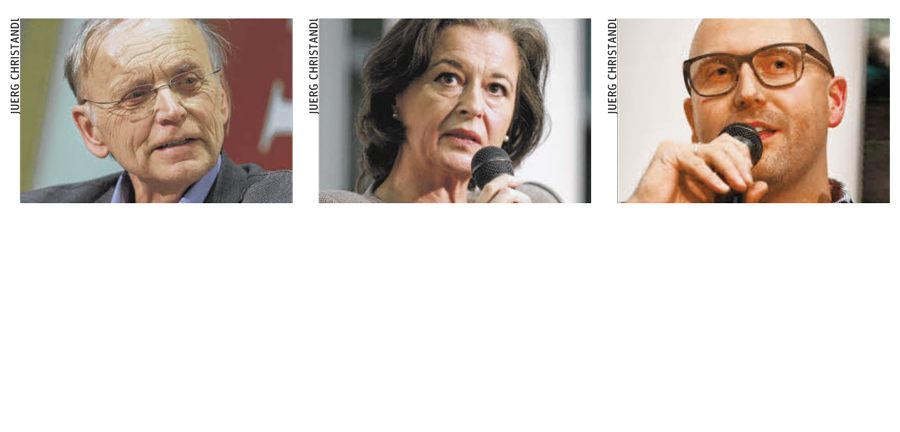Schwindeln macht das Sozialleben erst erträglich. Sogar in der Beziehung ist es mitunter ratsam, die Wahrheit zu vertuschen
 Nach neun Jahren, fand Martina, war es an der Zeit. Sie wollte Kinder und vorher noch heiraten. Weil ihr Freund, Christian ihr die Frage aller Fragen aber nie stellte, machte sie ihm irgendwann einen Antrag. Er lehnte ab. „Wenn du so fragst, wird mir klar: Ich warte seit Jahren darauf, etwas Besseres zu finden.“ Martina war am Boden zerstört: „Ich wünschte, ich hätte nie erfahren, dass er so denkt.“ Christian sagt: „Ich wollte nur ehrlich sein.“ Martina wäre lieber belogen worden. Die Lüge hat es schwer gegen die Wahrheitsliebe, die sich Menschen so gerne bescheinigen. Noch. Aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Ecken hört man in jüngster Zeit nämlich Plädoyers dafür, es mit der Ehrlichkeit nicht immer ganz genau zu nehmen. Ob Managerberater, Paartherapeuten, Philosophieprofessor – allesamt haben sie triftige Argumente für das gelegentliche oder gar systematische Lügen parat.
Nach neun Jahren, fand Martina, war es an der Zeit. Sie wollte Kinder und vorher noch heiraten. Weil ihr Freund, Christian ihr die Frage aller Fragen aber nie stellte, machte sie ihm irgendwann einen Antrag. Er lehnte ab. „Wenn du so fragst, wird mir klar: Ich warte seit Jahren darauf, etwas Besseres zu finden.“ Martina war am Boden zerstört: „Ich wünschte, ich hätte nie erfahren, dass er so denkt.“ Christian sagt: „Ich wollte nur ehrlich sein.“ Martina wäre lieber belogen worden. Die Lüge hat es schwer gegen die Wahrheitsliebe, die sich Menschen so gerne bescheinigen. Noch. Aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Ecken hört man in jüngster Zeit nämlich Plädoyers dafür, es mit der Ehrlichkeit nicht immer ganz genau zu nehmen. Ob Managerberater, Paartherapeuten, Philosophieprofessor – allesamt haben sie triftige Argumente für das gelegentliche oder gar systematische Lügen parat.
Wie erfolgreich das Nicht-Authentische sein kann, weiß etwa Stefan Wachtel. Der Executive Coach arbeitet mit Managern und Politikern – und rät ihnen, eben nicht echt zu sein. Man solle sich vielmehr so präsentieren, „wie man wahrgenommen werden will“, so Wachtel. Dass man Authentizität rein positiv assoziiere und auch im Berufsleben stets danach strebe, das Innere nach außen zu kehren, sei ein großer Fehler. „Wer immer so ist, wie er zu sein meint, vermittelt wenig soziale Kompetenz“, erklärt der Coach. „Jeder muss sich eine Rolle kreieren, in der definiert ist, was man sein und was man erreichen will.“ Dementsprechend solle man „professionell inszenierte Authentizität an den Tag legen“. Ein Widerspruch in sich, den der Coach aber „entscheidend für den beruflichen Erfolg“ nennt: „Lassen Sie Ihr Inneres, wo es ist!“
Vielleicht mag der eine oder andere jetzt denken, dass er nicht gut darin ist, anderen etwas vorzugaukeln, oder dass er gar nicht lügen will. Aber streng genommen belügt man sich damit nur selbst. Die meisten Menschen schwindeln ohnehin regelmäßig. Zwar nicht 200 Mal am Tag, wie es lange durch die Medien geisterte. Aber oft. So fand der US-Psychologe Robert Feldman bei Tests mit Studierenden heraus, dass sechzig Prozent der Erwachsenen in einer zehnminütigen Konversation lügen – im Schnitt zwei bis drei Mal.
Viele der Alltagslügen dienen dazu, sich in einem besseren Licht zu zeigen oder dem anderen ein besseres Gefühl zu geben. Da stimmt man jemandem zu, dessen Meinung man nicht teilt oder erfindet eine Verabredung, um sich vor einer Einladung zu drücken. „White lies“, sagt der Engländer dazu. „Harmlose Lügen“. Diese nicht ganz wahren Aussagen, darüber herrscht ein unausgesprochener Konsens, sind das Schmiermittel unserer Gesellschaft. Ohne sie wäre alles viel mühsamer, der Alltag ein Minenfeld von Kränkungen.
Doch bei den großen Themen – und auch das ist Konsens – soll man bitteschön unbedingt bei der Wahrheit bleiben. Warum eigentlich? Es fallen einem doch für das Liebesleben, für Freundesund Verwandt-
schaftsbeziehungen sofort Lügen ein, die das Leben viel leichter machen. Auch für den Belogenen.
Die Paartherapeuten Margot und Michael Schmitz haben im Juni „Ein Buch zur Sache“ – so der Untertitel – veröffentlicht, „Liebe Lust und Ehebett“ heißt es und spricht aus, was viele Menschen nicht hören wollen und andere nicht zu denken wagen. Nämlich: „Lügen gehören zur Beziehungspflege. Das Postulat ‚Du sollst nicht lügen‘ ruiniert Beziehungen.“ Und: „Erst recht treibt die Haltung in den Niedergang ,Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht‘. Damit ist für jede Beziehung schon das Todesurteil gesprochen.“ Vor allem vermeintlich ehrliche, aber letztlich destruktive Diskussionen gilt es zu vermeiden. Indem man sich eben nicht alles sagt („Deine Schwangerschaftsstreifen finde ich enorm unsexy“) – und nicht alles genau wissen will („Welche von meinen Freundinnen findest du eigentlich richtig scharf“?). Entscheidend wird das,
wenn Untreue ins Spiel kommt. Dazu muss man ein paar Wahrheiten nüchtern anerkennen: Ein Partner kann dem anderen nie alles geben, was der sich wünscht. So kommt es zu Verhältnissen, Seitensprüngen, Affären – die aber kein beziehungserschütterndes Drama sein müssen und nicht per se zeigen, dass etwas in der Beziehung im Argen liegt. Therapeut Michael Schmitz erklärt es so: „Es geht um Seitensprünge, die dem Paar-Partner nichts wegnehmen, die er nicht spürt und die den bestehenden Zusammenhalt des Paares nicht gefährden.“ Er nennt solche Affären, die Freiräume schaffen, gar „beschwingt“ – und rät eindringlich, sie durch Lügen zu verschleiern: „Wir müssen erkennen, wie das Leben nun mal ist und Denkvarianten annehmen, die helfen, die Anforderungen dieses realen Lebens zu bewältigen. So
können Paare glücklicher werden.“
Ein heimliches Verhältnis, so versichern die Therapeuten, könne sich sogar positiv auf die bestehende Partnerschaft auswirken. „Wer belebt und mit neuem Selbstbewusstsein, mit erfüllten Bedürfnissen zurückkommt, kann der Beziehung neue Impulse geben“, sagt Michael Schmitz. Aber eben nur, wenn er niemals
verrät, woher diese Impulse kommen. Häufig sind die Lügen, mit denen der Betrug gedeckt wurde, für die Betrogenen die größere Kränkung als der Seitensprung an sich. Gerade deshalb sieht Michael Schmitz keinen Grund, dem Partner diese Verletzung aktiv zuzufügen: „Mit dem Verschweigen schützt der Lügner sich selbst – aber eben auch den Partner. Er verletzt ihn nicht mit einer Wahrheit, die weder für ihn noch für die Beziehung eine Bedeutung hat.“ Daher sei es ungerecht, dem Lügenden seine Lügen vorzuwerfen. Er meint es ja gut!
Was aber, wenn sich ein Paar explizit auf gegenseitige Treue verständigt? Ein solcher Deal macht die Beziehung nicht unbedingt besser: „Der Mensch ist nicht auf Monogamie angelegt“, sagt Schmitz. Die Defizite und Kompromisse, die in einer monogamen Beziehung zwangsläufig erlebt werden, können auf Dauer unzufrieden machen.
Und dann? Bereits zwei Millionen Mal wurde das Video der Psychotherapeutin und Paarberaterin Esther Perel geklickt, die auf einer Ted-Konferenz zu „Rethinking infidelity“ dozierte: „Untreue neu denken“. Perel hält es ebenfalls für klug, den Partner und sich ein paar Wahr-
heiten zu ersparen.
„Für den Betrogenen ist es wichtig, sich die Neugierde nach Details zu verkneifen“, also Fragen nach dem wo und dem wann. Besser sei es, sich zu erkundigen, was dem Partner die Affäre bedeutet habe. Perel bietet paartherapeutische Sitzungen an, in denen sie einzeln mit den Partnern spricht und Ehrlichkeit lediglich ihr als Therapeutin gegenüber verlangt. Das Paar aber soll und muss sich nicht alles sagen. Die psychoanalytische Regel, dass Wahrheit heilt, wird auch von Margot und Michael Schmitz angezweifelt: „Im Laufe der Jahre ist bei uns die Überzeugung gewachsen, dass sie oft mehr schadet als nutzt.“
Nun fürchten manche Menschen um das Vertrauen, das Gemeinschaften zusammenhält. Tatsächlich plädiert LügenForscher Robert Feldman in seinem Standardwerk „Lügner“ aus eben diesem Grund, selbst auf Schwindeleien wie „Dein Kleid sieht toll aus“ zu verzichten.
Doch könnte man nicht langsam ein neues Verständnis von Vertrauen etablieren? Das sich dadurch definiert, den anderen ihre kleinen Tricks und Geheimnisse zuzugestehen? „Es geht beim Vertrauen nicht um einen Wahrheitsfanatismus“, sagt der Philosophieprofessor Franz Josef Wetz. Er beschäftigt sich seit mehr als zehn Jahren mit Wahrheit und Lüge. „Einander zu vertrauen bedeutet nicht, sich immer alles sagen zu wollen und zu müssen. Sondern sicher sein zu können, dass der andere das sagen wird, was für beide und die Beziehung wichtig ist. Und anderes eben nicht.“ So könne man miteinander aufrichtig sein, ohne immer ehrlich sein zu müssen.
In der Bibel übrigens wird in den zehn Geboten nur eine ganz spezielle Form der Lüge untersagt: Die Falschaussage („Du sollt nicht falsch Zeugnis ablegen wider deinem Nächsten“). Franz Josef Wetz nennt drei Formen von Unwahrheiten als zentral im Alltag: Das Verschweigen von Wahrheiten, das Leugnen von Verdächtigungen, das aktive Lügen durch das Erfinden von Geschichten.
All das klingt nicht unbedingt sympathisch – und doch gelten gerade Lügner als sozial geschickt und sensibel. Denn umgekehrt gilt: Wer häufig unverblümt die Wahrheit sagt, ist in seinem Umfeld unbeliebter. „Lügen ist keine Unart, sondern eine Fähigkeit, Kompetenz und Lebenstechnik“, sagt Wetz. In rund fünfzig Prozent der Fälle erzählen Menschen aus prosozialen Gründen die Unwahrheit. In Freundschaften und Beziehungen wird meist gelogen, um Belastungen zu vermeiden, die Beziehung vor Gefährdungen zu schützen und um das Selbstwertgefühl des Partners aufzubauen. Dass dabei gleichzeitig auch egoistische Motive erfüllt werden, darf man annehmen – und als Gewinn verbuchen.
„Ehrlichkeit ist manchmal nur grausame Gefühlsrohheit“, sagt Wetz. Er erkennt im Lügen eine ganz eigene Form der Nähe zum Belogenen: „Die Wahrung eines Geheimnisses kann von besonderem Einfühlungsvermögen und sensibler Zuneigung zeugen.“ Frauen beherrschen diese Form der Lüge übrigens besser als Männer. Und Frauen sind es auch, die sich mit
diesem Thema verstärkt auseinandersetzen. „In meine Lesungen und Vorträge kommen bis zu 70 Prozent Frauen“, berichtet Wetz. „Männer lügen, denken aber nicht so viel darüber nach.“ Insgesamt sei es ein Thema, das spalte: „Ich erfahre entweder große Zustimmung oder absolute Ablehnung. Interessanterweise steigt die Zustimmung mit dem Alter, gerade älteren Studenten ab etwa 40 Jahren sind meist auf meiner Seite, während die jungen Studierenden moralisch noch sehr rigoros sind. Denen ist das Leben noch nicht passiert.“
Dabei ist es doch so: Auch wenn die meisten Menschen die Wahrheit lautstark einfordern und für sich beanspruchen, wollen sie diese nicht bedingungslos hören. Die Forschung belegt, dass Menschen Lügen in vielen Fällen nicht nur stillschweigend akzeptieren, sondern sie sich sogar wünschen. Besonders motiviert, Unwahrheiten anzunehmen, ist man, wenn sie schmeichelhaft und konsistent mit dem eigenen Selbstbild sind. Doch damit diese Mechanismen funktionieren, muss der öffentliche Diskurs die Lüge verdammen – sonst wären die Aussagen ja nichts mehr wert.




 „Ich will mir selbst treu bleiben. Keinem etwas vormachen. Mich nicht verbiegen oder vereinnahmen lassen. Ich will ich sein. Authentisch!“ (O-Ton eines Managers)
„Ich will mir selbst treu bleiben. Keinem etwas vormachen. Mich nicht verbiegen oder vereinnahmen lassen. Ich will ich sein. Authentisch!“ (O-Ton eines Managers)




 Der Hype ist ausgebrochen. Um Guardiola, Klopp, van Gal, Mourinho und Ancelotti, sogar um ein High-Potential wie Thomas Tuchel, der sich erst noch beweisen muss. Selbst der schweizerisch-temperierte Marcel Koller ist auf dem Weg zum Kult-Status.
Der Hype ist ausgebrochen. Um Guardiola, Klopp, van Gal, Mourinho und Ancelotti, sogar um ein High-Potential wie Thomas Tuchel, der sich erst noch beweisen muss. Selbst der schweizerisch-temperierte Marcel Koller ist auf dem Weg zum Kult-Status.